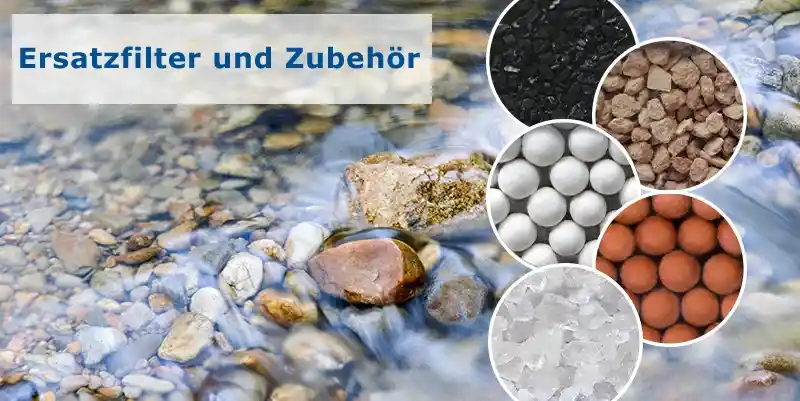Spülschwämme – eine der unterschätzten Quellen für Mikroplastik
Was viele nicht ahnen: Spülschwämme gehören zu den häufigsten Verursachern von Mikroplastik im Haushalt. Mit jeder Bewegung über das Geschirr lösen sich winzige Kunststoffpartikel – völlig unauffällig, aber mit weitreichenden Folgen. Ein Großteil davon gelangt über das Abwasser in Flüsse und Meere. Und was dort landet, bleibt nicht dort.
Die meisten herkömmlichen Schwämme bestehen aus Polyurethan oder Polyester. Diese Kunststoffe sind günstig und flexibel, aber nicht stabil. Schon nach wenigen Anwendungen beginnt die Oberfläche zu zerfasern – besonders beim Reinigen von Töpfen oder eingebranntem. Der Abrieb ist oft unsichtbar, aber messbar.

Ein Bericht des Fraunhofer UMSICHT schätzt, dass allein durch Reinigung und Spülen in privaten Haushalten jedes Jahr mehrere tausend Tonnen Mikroplastik in die Umwelt gelangen. Die Studie benennt als Quellen unter anderem den Abrieb von Kunststoffprodukten wie Putzschwämmen, Bürsten oder anderen Reinigungsutensilien – Spülschwämme werden dabei nicht separat aufgeführt, gehören aber eindeutig in diese Kategorie.
In
Deutschland gibt es rund 41 Millionen Privathaushalte, in denen regelmäßig
konventionelle Kunststoffspülschwämme verwendet werden. Geht man davon aus,
dass pro Schwamm im Laufe seiner Nutzung durchschnittlich bis zu 15 Gramm
Mikroplastik freigesetzt werden, ergibt sich ein jährlicher Gesamteintrag von
etwa 30 Tonnen Mikroplastik allein durch Spülschwämme. Diese Hochrechnung auf
Basis von Markt- und Verbrauchsdaten zeigt deutlich: Auch alltägliche
Haushaltsprodukte tragen messbar zur Mikroplastikbelastung bei.
Mikroplastik bleibt nicht im Abfluss
Was nicht in der Kanalisation landet, bleibt auf dem Teller, auf der Arbeitsfläche oder an den Händen. Dort können auch Rückstände von Produktionschemikalien wie Weichmachern oder Farbstoffen haften – Stoffe, die nicht in die Küche gehören.
Gleichzeitig sind Schwämme ein hygienisches Risiko: Feuchtigkeit, Wärme und Struktur schaffen ideale Bedingungen für Keime. Ein Schwamm, der länger im Einsatz bleibt, kann schnell selbst zur Belastung werden – statt zur Reinigung beizutragen.
Was wir tun könnten:
Eine einfache Maßnahme: den Schwamm wechseln. Statt synthetischer Varianten bieten plastikfreie Alternativen wie der Luffa Trio Schwamm gleich mehrere Vorteile:
- Kein Mikroplastik – der Schwamm besteht vollständig aus pflanzlichen Materialien, also ohne synthetische Fasern.
- Zersetzbar – er kann nach Gebrauch in den Biomüll oder auf den Kompost.
- Schnelltrocknend und auskochbar – dadurch hygienischer als viele klassische Varianten.
- Vielseitig – die Luffa-Seite eignet sich zum Scheuern, die Zelluloseseite für empfindliche Oberflächen – auch im Bad.
Die Umstellung kostet wenig – aber sie macht einen Unterschied. Jeden Tag.
Beim Spülen mit Kunststoffschwämmen lösen sich durch Abrieb winzige Plastikpartikel – meist unsichtbar, aber stetig. Diese Mikroplastikpartikel gelangen mit dem Spülwasser in den Abfluss und weiter in die Kanalisation. In der Kläranlage können viele davon nicht vollständig zurückgehalten werden, weil sie zu klein sind. Über das gereinigte Abwasser gelangen sie in Flüsse, Seen – und schließlich ins Meer.
Mikroplastik, das nicht mit dem Wasser weitergeleitet wird, bleibt im Klärschlamm zurück. Dieser Schlamm wird in vielen Regionen als Dünger auf Feldern eingesetzt. So gelangen die Kunststoffpartikel auf Böden, wo sie sich langfristig anreichern können. Von dort aus ist der Weg ins Grundwasser oder über Pflanzen in die Nahrungskette nicht weit.
Im Meer landet Mikroplastik in der Nahrungskette. Plankton und kleine Organismen nehmen die Partikel auf – meist unbeabsichtigt. Fische, Muscheln oder Garnelen fressen diese Tiere oder filtern das Wasser selbst und nehmen dabei Mikroplastik auf. Beim Verzehr solcher Meerestiere können auch wir diese Partikel aufnehmen – ohne es zu merken.
Nicht ganz. Ein Teil unseres Trinkwassers stammt aus Oberflächenwasser – also aus Flüssen und Seen. Wenn diese mit Mikroplastik belastet sind, kann auch das Leitungswasser davon betroffen sein. Untersuchungen zeigen, dass selbst in aufbereitetem Wasser mitunter kleinste Kunststoffpartikel nachweisbar sind.
Mikroplastik ist nicht nur ein Thema für Gewässer. Über Klärschlamm gelangt es auch in Böden, wo es sich kaum abbaut. Es kann dort die Bodenstruktur verändern und Bodenorganismen schädigen. Zusätzlich können winzige Partikel durch Luftbewegungen weitergetragen werden – etwa beim Staubsaugen, Waschen oder durch Abrieb in der Raumluft.
Typische Quellen sind das Spülen mit Kunststoffschwämmen, das Putzen mit Mikrofasertüchern oder das Waschen synthetischer Kleidung. Auch Reinigungsmittel mit Kunststoffen in flüssiger Form tragen bei. Wer auf plastikfreie Alternativen setzt – bei Schwämmen, Tüchern oder Textilien – kann seinen Mikroplastik-Ausstoß im Alltag deutlich senken.