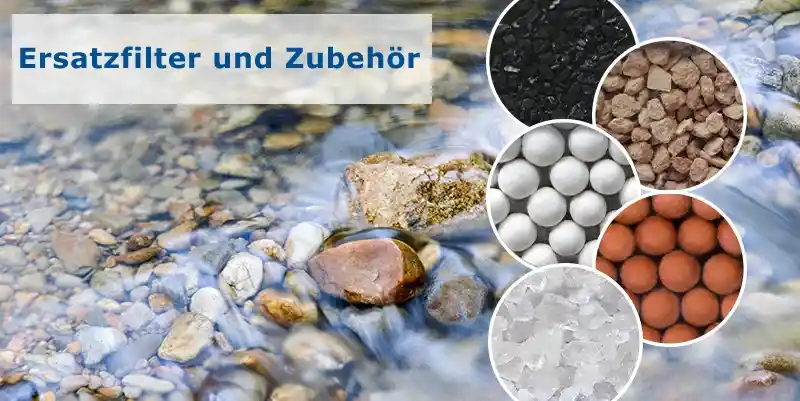Der Umgang mit Wasser ist entscheidend für die Qualität von Wasser
Wasser- ohne Wasser würde es nichts geben, wir könnten noch
nicht einmal atmen ohne das wertvolle Nass.
Wer kennt nicht das geflügelte Wort- oder in diesem Fall besser den
geflügelten Satz: „Ohne Wasser ist alles nichts“.
Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde und zugleich eine Ressource,
mit der wir jeden Tag in Berührung kommen.
Ob beim Duschen, Kochen, Wäschewaschen oder Putzen: Unser täglicher Wasserverbrauch verursacht jede Menge Abwasser. Doch was kippen wir eigentlich alles in den Abfluss? Welche Belastungen entstehen dadurch für unsere Wasserwerke, und was leisten diese, um unser Trinkwasser weiterhin sauber zu halten? Außerdem betrachten wir, welche Rolle ein Wasserfilter nach der Aufbereitung durch die Wasserwerke noch spielen kann und wie Sie persönlich zur Verbesserung der Wasserqualität beitragen können.
Warum Ihr Umgang mit Abwasser so wichtig ist
Wenn wir Wasser aus dem Hahn nutzen, denken viele von uns nur selten darüber nach, was mit dem gebrauchten Wasser danach geschieht. Das „verschwundene“ Wasser fließt jedoch nicht einfach ins Nichts – es landet in der Kanalisation und wird in Kläranlagen (auch Wasserwerke oder Abwasserwerke genannt) gereinigt. Dort durchläuft es mehrere Reinigungsstufen, bevor es entweder in Flüsse und Seen geleitet oder als gereinigtes Wasser wiederverwendet wird.
Der Haken: Je stärker unser Abwasser belastet ist, desto aufwendiger ist die Reinigung. Schadstoffe, die Sie leicht hätten vermeiden können, bleiben oft hartnäckig im Wasser und erfordern spezielle, zum Teil energieintensive und kostspielige Verfahren. Jeder von uns kann daher maßgeblich zur Wasserqualität beitragen, indem wir bewusst und verantwortungsvoll mit Abwasser umgehen.

Fette und Öle
Nach dem Braten ist die Pfanne voller Fett, und häufig
landet das restliche Bratfett oder Öl direkt im Abfluss. Doch Fette verklumpen
in den Leitungen und können in der Kanalisation sogar „Fettberge“ bilden. Das
führt zu Verstopfungen und verursacht hohe Kosten für die Kommunen, die diese
Rückstände mühsam entfernen müssen.
Essensreste
Nudeln, Reis, Kaffeefilter oder andere Lebensmittelreste
werden rasch im Abfluss oder in der Toilette entsorgt. Diese organischen Stoffe
sorgen jedoch für Bakterienwachstum und können die Abwasserreinigung
erschweren.

Medikamente
Viele entsorgen abgelaufene oder nicht mehr benötigte
Arzneimittel einfach, indem sie sie in der Toilette herunterspülen. Dabei
gelangen Wirkstoffe ins Abwasser, die in konventionellen Kläranlagen nur schwer
oder gar nicht abgebaut werden. Letztendlich können sie in unsere Gewässer und
sogar ins Grundwasser gelangen.
Was bereits Probleme bereitet und oft übersehen wird: Über den Urin gelangen
beträchtliche Mengen an Medikamentenrückständen ins Abwasser,
weil unser Körper viele Wirkstoffe nicht vollständig abbaut. So tragen allein
die Ausscheidungen von Menschen, die regelmäßig Medikamente einnehmen, erheblich
zur Belastung bei.

Putz- und Reinigungsmittel
In Haushalten werden unzählige Reinigungsmittel benutzt –
von Spezialreinigern für das Bad bis hin zu Desinfektionsmitteln, Bleichmitteln
oder aggressiven Chemikalien. Diese Stoffe können Wasserorganismen in Flüssen
und Seen gefährden und natürliche Reinigungsprozesse in Kläranlagen stören,
wenn sie in zu großen Mengen ins Abwasser gelangen.
Kosmetikprodukte & Mikroplastik
Kosmetika wie Peelings, Zahncremes oder Duschgele enthalten
oft Mikroplastik. Über den Abfluss gelangen diese winzigen Partikel ins
Abwasser. Mikroplastik ist nur schwer zu entfernen und sammelt sich in der
Umwelt an.
Farben und Lacke
Auch das Auswaschen von Farbeimern oder die Entsorgung von
Lösungsmittelresten im Waschbecken kommt häufiger vor, als man meinen könnte.
Diese chemischen Substanzen können toxisch wirken und dürfen keinesfalls in die
Kanalisation gelangen.
Ein paar Zahlen zur Verdeutlichung
In Deutschland verbraucht jede Person durchschnittlich rund 127 Liter Wasser pro Tag (Stand: ca. 2020–2022).
Laut Schätzungen landen jährlich mehrere Tonnen Medikamente (insbesondere Schmerzmittel und Antibiotika) im deutschen Abwasser. Doch selbst wenn Medikamente korrekt eingenommen werden, ist der Eintrag in die Gewässer nicht unerheblich: Viele Wirkstoffe werden im Körper nur zum Teil abgebaut und gelangen über den Urin in die Kanalisation. Ein Beispiel dafür ist die Antibabypille. Die darin enthaltenen Hormone (z. B. Ethinylestradiol) werden zu einem großen Teil über den Urin ausgeschieden – Studien zufolge können das je nach Wirkstoff und Person bis zu 90 Prozent sein. Nur ein kleiner Anteil verbleibt also tatsächlich im Körper; der Rest wird weitertransportiert ins Abwasser und kann so letztlich auch in die Umwelt und in Gewässer gelangen.
Allein das Entfernen von Fettbergen und Verstopfungen in öffentlichen Kanalnetzen kostet deutsche Kommunen mehrere Millionen Euro im Jahr.
Diese Beispiele verdeutlichen, dass ein bewusster Umgang mit Abwasser nicht nur die Umwelt schont, sondern auch Kosten und Ressourcen spart.
Die Mehrarbeit für Wasserwerke: Was sie leisten und wo ihre Grenzen liegen
Wasserwerke bzw. Kläranlagen haben in der Regel ein Mehrstufensystem, um das Abwasser zu reinigen:
Mechanische Reinigung
Grobe Bestandteile wie Papier, größere Schmutzpartikel oder Hygieneartikel
werden mittels Rechen und Sieben entfernt. Auch das Absetzen von Sand und
Schlamm in Absetzbecken zählt zu diesem Schritt.
Biologische Reinigung
Mikroorganismen bauen in Belebungsbecken organische Verschmutzungen (etwa
Speisereste, Fette) ab. Dieser Schritt ist sehr effektiv, kann aber bei
Überlastung oder hochgiftigen Chemikalien an seine Grenzen stoßen.
Chemische Reinigung (ggf. erweiterte Stufe)
In manchen Kläranlagen kommen chemische Flockungsmittel zum Einsatz, um
Phosphate oder andere Stoffe auszufällen. Dies ist notwendig, um Überdüngung
von Gewässern zu verhindern.
(Optionale) vierte Reinigungsstufe
Moderne Anlagen setzen oft eine zusätzliche Stufe ein, zum Beispiel
Aktivkohlefilter oder Ozon, um Mikroverunreinigungen wie
Arzneimittelrückstände, hormonaktive Substanzen oder Pestizide bestmöglich zu
entfernen.
Mikroplastik ist schwierig zu entfernen und gelangt teils in den Klärschlamm, während ein anderer Teil im Wasserkreislauf verbleibt.
Pharmazeutische Rückstände und Hormone erfordern aufwendige Verfahren (zum Beispiel Ozonierung oder Aktivkohlefiltration), die kostspielig sind und nicht überall eingesetzt werden.
Industriechemikalien oder giftige Lösungsmittel können bereits in sehr geringen Mengen hochproblematisch sein.
Hier zeigt sich deutlich: Je weniger kritische Stoffe im Abwasser ankommen, desto effektiver, kostengünstiger und ressourcenschonender kann die Reinigung erfolgen. Jeder Einzelne, der im Haushalt umsichtig ist, entlastet die Wasserwerke und schont so die Umwelt.
Fette und Öle richtig entsorgen:
Lassen Sie Bratfett abkühlen und geben Sie es zum Beispiel in ein altes
Schraubglas oder wickeln Sie es in Zeitungspapier, bevor Sie es in den Restmüll
werfen. So verhindern Sie Verstopfungen in den Rohren und Fettberge in der
Kanalisation.
Medikamente korrekt entsorgen:
Abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel sollten Sie über spezielle
Sammelstellen, Apotheken (sofern angeboten) oder über den Hausmüll in
originaler Verpackung (unter Beachtung der lokalen Entsorgungshinweise)
entsorgen – niemals in der Toilette.
Haushaltsreiniger sparsam verwenden:
Achten Sie auf umweltfreundliche, biologisch abbaubare
Reiniger und verwenden Sie diese nur in der empfohlenen Menge. So vermeiden Sie
unnötige Belastungen und sparen Geld.
Mikroplastik reduzieren
Verzichten Sie auf Kosmetik- und Pflegeprodukte mit
Mikroplastikpartikeln. Immer mehr Hersteller setzen auf zertifizierte
Naturkosmetik und kennzeichnen ihre Produkte entsprechend.
Keinen Abfall in die Toilette werfen:
Feuchttücher, Zigarettenkippen, Tampons oder Binden gehören
in den Restmüll – nicht in die Toilette. Das verhindert Verstopfungen und
reduziert den Reinigungsaufwand in den Kläranlagen.
Umweltbewusst einkaufen:
Entscheiden Sie sich für Produkte mit weniger oder
recycelbarer Verpackung, biologisch abbaubaren Materialien und ökologischen
Alternativen. So schonen Sie von Beginn an die Ressourcen, einschließlich des
Wassers.
Die Rolle des Wasserfilters: Was nach dem Wasserwerk noch
passiert
Selbst, wenn das Wasserwerk großartige Arbeit leistet, entscheiden sich immer
mehr Menschen für einen zusätzlichen Wasserfilter im Haushalt. Was sind die
Gründe?
Feinstoffliche Partikel und Restbelastungen
Je nach Alter des Rohrleitungssystems können winzige Partikel von Kalk, Rost
oder anderen Ablagerungen ins Trinkwasser gelangen. Aktivkohle- oder
Sedimentfilter helfen dabei, die Wasserqualität weiter zu verbessern.
Reduktion von Geruchs- und Geschmacksstoffen
Manche Menschen reagieren empfindlich auf Chlor oder andere Stoffe, die zwar
gesundheitlich unbedenklich sind, jedoch den Geschmack beeinflussen. Ein
Wasserfilter kann diese Stoffe binden und neutralisieren.
Zusätzliche Sicherheit bei Mikroverunreinigungen
Moderne Filtersysteme (z.B. Aktivkohle, Umkehrosmose) sind in der Lage, selbst winzige Rückstände wie Pestizide, Hormone und Arzneimittelwirkstoffe zu binden.
So werden Sie zum Wasserschützer!
Die Qualität unseres Trinkwassers hängt nicht allein von Hightech-Klärwerken und moderner Aufbereitungstechnik ab. Vor allem unser persönliches Verhalten spielt eine entscheidende Rolle. Jeder Liter, den wir verbrauchen, muss im Anschluss gereinigt werden. Senken wir die Schadstoffbelastung, sparen wir Kosten, Energie und Ressourcen – und verbessern gleichzeitig die Wasserqualität in Flüssen, Seen und im Grundwasser.
Mit diesen Schritten leisten Sie einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltig saubere Wasserversorgung. Jede noch so kleine Handlung kann Großes bewirken, denn unser wertvolles Wasser ist die Grundlage für Gesundheit, Artenvielfalt und Lebensqualität – heute und für kommende Generationen.